Partner- und Gruppenarbeit auf Diagnose ausrichten
„Partner- und Gruppenarbeit gehören nicht nur zum methodischen Standardrepertoire einer jeden Lehrkraft, um den Unterricht abwechslungsreich und möglichst schüler-aktivierend zu gestalten. Diese Sozialformen lassen sich auch gut für diagnostische Zwecke nutzen. Dabei werden Aufträge so gestaltet, dass Schüler die Lösung von Aufgaben aushandeln müssen, und „Spuren“ dieser Diskussion erhalten bleiben. Dadurch können Lehrkräfte besser erkennen, welche Schülervorstellungen hinter den Lösungen stecken. Gleichzeitig sind die Schüler aktiv und helfen sich gegenseitig dabei, ihr Können besser einzuschätzen.
Partnerdiagnose-Bögen
Mit Diagnosebögen für den Einsatz in Partnerarbeit lassen sich geschickt Mitschüler
zur Unterstützung bei Diagnosen heranziehen. Hierbei wird beispielsweise ein Satz an Aufgaben gelöst oder es werden Behauptungen auf ihren Wahrheitsgehalt hin geprüft.
Jeder Schüler bildet sich zunächst allein eine begründete Meinung, dann wird mit einem Mitschüler diskutiert. Sind Korrekturen erforderlich, erfolgen diese mit einer
anderen Farbe. So kann die Lehrkraft nach dem Einsammeln der Diagnosebögen auf einen Blick erkennen, an welchen Stellen Unklarheiten auftauchten – sie kann quasi die Spuren der Partnerdiskussion nachvollziehen und darüber entscheiden, wie mit den Schülern noch vorhandene Unklarheiten beseitigt werden können. Dieses Vorgehen lässt sich auch leicht auf andere Fächer übertragen.
(…)
Concept-Maps
In Phasen der Wiederholung oder Festigung von Inhalten hat sich die Methode des Concept-Mappings bewährt, um mehr über Schülervorstellungen zu erfahren. Dabei werden Schüler aufgefordert, aus einer Liste von Fachbegriffen eine „Begriffs-landkarte" (Concept Map) zu erstellen, indem sie die Begriffe miteinander in Beziehung setzen, diese durch Linien verbinden und die Beziehungen benennen, um die Art des Zusammenhangs zu spezifizieren. (…)
Setzt man diese Methode als Diagnoseinstrument ein, empfiehlt es sich, die Schüler in Kleingruppen Concept-Maps erstellen und aushandeln zu lassen. Bereits hier wird für die Lehrkraft sichtbar, bei welchen Zusammenhängen starker Diskussionsbedarf
herrscht. Gibt man den Schülern anschließend noch die Gelegenheit, sich die Concept-Maps der übrigen Gruppen erklären zu lassen, ergeben sich zwei Effekte:
- Die Lehrkraft erhält als Beobachter auf sehr effektive Weise ein differenziertes Bild davon, welche Begriffe die Schüler so verinnerlicht haben, dass sie sie zum Aufzeigen von Zusammenhängen nutzen können.
- Die Schüler kommen massiv „zu Wort“ und ihnen wird oft erst beim Verbalisieren bewusst, wo sie noch Verständnisprobleme haben.“
(aus: Pädagogisch diagnostizieren im Schulalltag. ISB München 2008, S. 17 f.)
Folgende Anweisungen für das Erstellen einer Concept-Map haben sich bewährt:
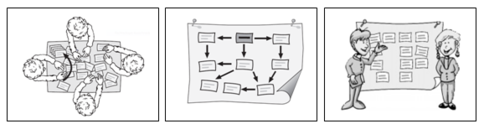
1. Sortieren:
Schaut euch die Begriffe (Kärtchen) an und legt die weg, die ihr nicht kennt oder nicht gebrauchen könnt.
2. Strukturieren:
Ordnet die Kärtchen auf einem Blatt zu einem Netz. Legt Begriffe, die zusammengehören näher zusammen.
3. Kleben:
Klebt die Begriffe auf das Papier.
4. Beschriften und ergänzen:
Zeichnet Pfeile zwischen den Begriffen, die zusammengehören. Schreibt kurze Erklärungen an die Pfeile.
Seht euch die weggelegten Karten an. Wenn sie passen, dann klebt sie dazu.
5. Präsentieren:
Präsentiert euer Begriffsnetz der Klasse. Regel: Jeder muss dabei sprechen.
(Quelle: Staatliches Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien Koblenz)
Diese Seite als ![]() Download
Download
Beispiele aus den Fächern
| Fach | Gegenstand der Diagnose | Jg.-stufe | Download |
|---|---|---|---|
| Naturwissenschaften (Chemie) | Salzbildung | 9 - 10 | |